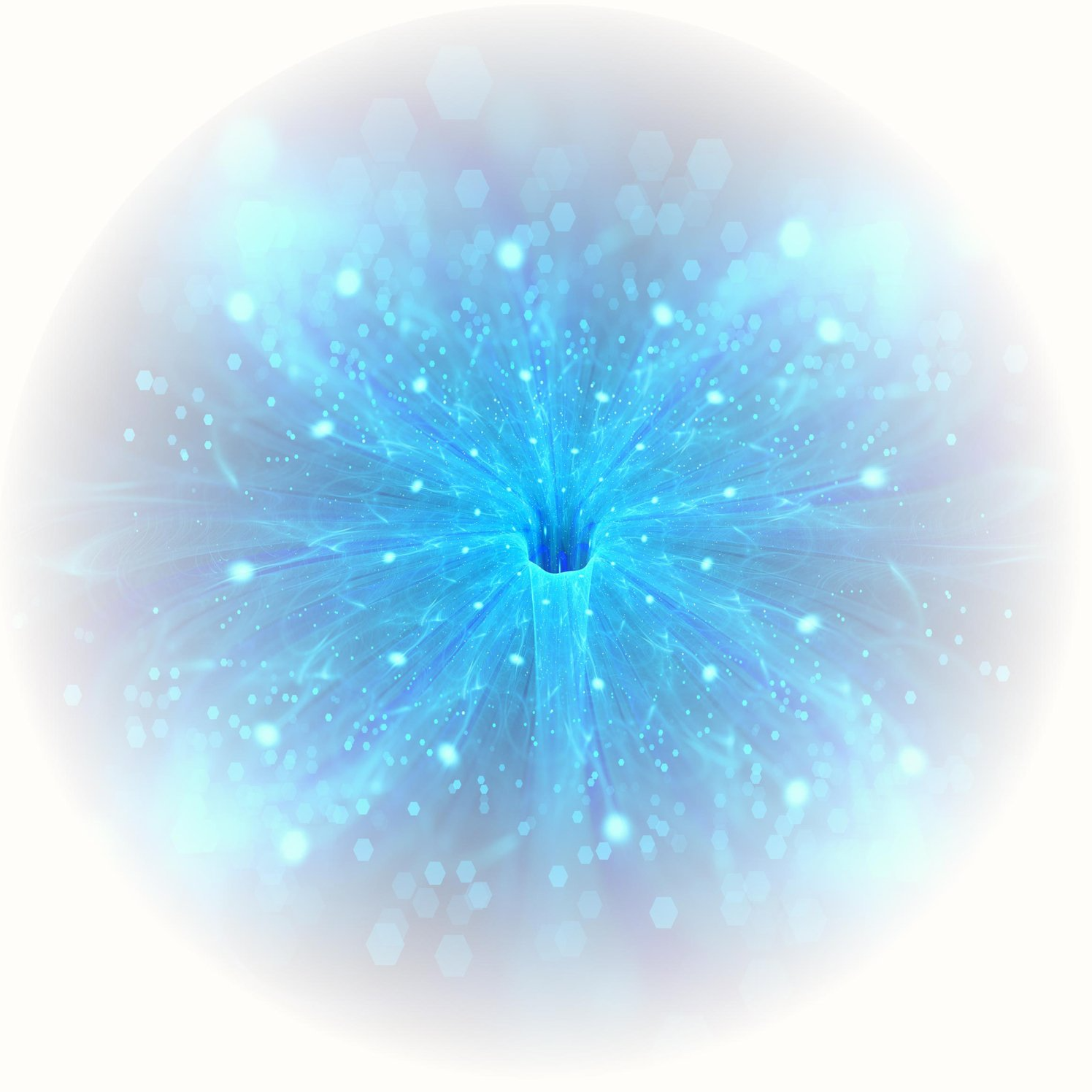Moro-Reflex
"Beeinflussung emotionaler Reaktionsmuster in besonderer Weise"
-
Herausbildung und Auslösung
Herausbildung
Der Moro-Reflex bildet sich zwischen der 9. – 12. Schwangerschaftswoche aus, ist bei der Geburt vollständig präsent und wird ca. im 4. Lebensmonat gehemmt und in eine erwachsenen Schreckreaktion umgewandelt.
In der ersten Phase kommt es zu einer plötzlich symmetrischen Aufwärtsbewegung der Arme und Beine, der Kopf legt sich in den Nacken, die Hände öffnen sich und es folgt ein Einatmen.
In der zweiten Phase folgt nach einem kurzen Erstarren die Umkehr der Bewegung, d.h., Arme, Beine und Hände schließen sich, der Kopf geht zur Brust, es kommt zur Ausatmung und möglicherweise zu einem Schrei.
Auslösung
Der Moro-Reflex kann durch plötzliche und unerwartete Reize auf allen sensorischen Ebenen (vestibulär, auditiv, visuell, olfaktorisch, gustatorisch, taktil, emotional) ausgelöst werden.
-
„Das große Thema“
„Das große Thema“
Er wird als Schreck/-Angstreflex bezeichnet, da er eine unwillkürliche Reaktion auf eine gefühlte Bedrohung darstellt, zeigt eine sympathische/erregende Reaktion, d.h., das Kind befindet sich bei Auslösung immer in einem “Kampf oder Flucht“ – Verhalten.
-
Aufgaben
Aufgaben
- Vorgeburtlich trainiert er die Atmung, aktiviert erste Bewegungsreaktionen auf einen Reiz bspw. einen Gleichgewichtsreiz aufgrund der Bewegungen der Mutter und trainiert damit die Muskulatur. Nachgeburtlich hat er eine Alarmfunktion, ermöglicht dem Kind, durch Schreien Hilfe herbeizuholen.
- Mit Integration kommt es zu einer angemessenen Reizfilterung in allen Sinneskanälen.
-
Wirkung über die Waltezeit hinaus
Wirkung über die Waltezeit hinaus
- Ein über die physiologische Waltezeit hinaus aktiver Moro-Reflex kann in besonderer Weise die emotionalen Reaktionsmuster und die jeweilige Stressschwelle eines Menschen ein Leben lang beeinflussen, da er sich seelisch und körperlich ständig an der Schwelle zu Kampf- oder Fluchtreaktionen und damit immer in Alarmbereitschaft, in einem ständigen Zustand erhöhter Aufmerksamkeit befindet.
- Er befindet sich somit in einer Hypersensitivität in einem oder mehreren sensorischen Kanälen, reagiert möglicherweise auf bestimmte Reize über, da es zu einer übersteigerten Wahrnehmung und zu keinem Ausfiltern irrelevanter Reize und somit zu einer Reizverarbeitungsschwäche kommt, die sich als nach außen gerichteter Aktion (Kampf) oder als nach innen kehrende Schutzhaltung (Flucht) zeigen kann.
- Die noch vom Moro-Reflex geleiteten Menschen mögen nichts Neues, Unbekanntes oder Unverhofftes, suchen kompensierende Maßnahmen, um die Auslösung zu vermeiden und die an sie gestellten Erwartungen erfüllen zu können, beispielsweise durch die Neigung Situationen manipulieren, kontrollieren und absichern zu wollen als Versuch Strategien zu finden, die ihm ein gewisses Maß an Kontrolle über seine eigenen emotionalen Reaktionen gewähren.
- Ein noch aktiver Moro-Reflex bringt die Anregung der Produktion und Freisetzung der Stresshormone Adrenalin und Cortisol – als Hauptabwehrstoffe gegen Allergien und Infektionen – mit sich, so dass durch ein häufiges Auslösen dieses Reflexes möglicherweise unzureichende Vorräte beider Stoffe im Körper vorhanden sind. Daraus folgt eine unzureichende Immunität und eine unausgewogene Reaktion auf Allergene – häufige Infekte und Haut -oder Atemwegserkrankungen.
- Aufgrund der Persistenz von Resten sehr frühkindlicher Reaktionsmuster auf Gefahr kann das Nervensystem einen Prozess auslösen, der auf Stammhirnebene die Rückmeldung von Gefahr erfolgen lässt, auch, wenn diese gar nicht real besteht, die Aktivierung des parasympathischen oder sympathischen Nervensystems zur Folge einleitet und sich entweder im Abfall des Muskeltonus, Handlungsunfähigkeit, Gefühl von Hilflosigkeit, … oder Sinneseindrücken ohne Abgrenzung ausgeliefert zu sein, … zeigen und somit an Angststörungen, Panikattacken und psychosomatischen Erkrankungen mitbeteiligt sein kann.
- Weitere Auswirkungen können sich als Störungen in der Augenmotorik und der visuellen Wahrnehmung zeigen, d.h., als Schwierigkeit die visuelle Aufmerksamkeit auf das Zentrum gerichtet zu halten, da diese auf äußere Umrisse und auf plötzliche Bewegungen und Lichtwechsel in der Peripherie gerichtet ist. Daraus folgt möglicherweise eine leichte Ablenkbarkeit in Form einer hohen Stimulusgebundenheit und einer geringen Fixation. Pupillen reagieren möglicherweise nicht richtig auf Licht – den Kindern ist es zu hell (bspw. Neonröhren in Klassenzimmern), Buchstaben tanzen, vor allem schwarze Buchstaben auf weißem Grund.
Es gibt viele andere Erscheinungsbilder einer persistierenden Restreaktion des Moro-Reflexes.

Tonischer Labyrinthreflex
"Ich weiß nicht wo mir der Kopf steht!“ oder „Verloren in Zeit und Raum."
-
Herausbildung und Auslösung
Herausbildung und Auslösung
Beginnend mit dem TLR vorwärts, der sich ab der 12. SSW bildet und bis zum ca. 4. Lebensmonat bestehen bleibt, löst er durch eine Beugung des Kopfes nach vorn eine Gesamtkörperbeugung aus.
Der TLR rückwärts, als zweiter Teil des Reflexes, bildet sich unter der Geburt aus und kann bis zum 3 ½. Lebensjahr bestehen bleiben. Er löst durch eine Streckung des Kopfes nach hinten eine Gesamtkörperstreckung aus.
-
„Das große Thema“
„Das große Thema“
Der Tonische Labyrinthreflex steht im Großen und Ganzen für einen angemessenen Tonusaufbau und bildet damit die Grundlage für Gleichgewicht und Orientierung.
-
Aufgaben
Aufgaben
- Vorgeburtlich hält der TLR vorwärts das Kind in der Beugehaltung im Uterus. Unter der Geburt stellt der TLR rückwärts durch seine Streckung eine aktive Hilfe des Kindes dar. Nachgeburtlich ist er die erste aktive Antwort auf die Schwerkraft und beeinflusst den gesamten Muskeltonus.
- Mit Integration des TLR entwickelt sich die willkürliche Kopfkontrolle in Bauchlage, die eine Bewegung des Kopfes ohne Veränderung des Muskeltonus zulässt, das Gleichgewicht nicht stört, feste räumliche Bezugspunkte und somit ein gesicherter Aufbau in der Einschätzung von Raum/Richtung, Entfernung, Tiefe und Geschwindigkeit entstehen lässt.
-
Wirkung über die Waltezeit hinaus
Wirkung über die Waltezeit hinaus
- Ein über die physiologische Waltezeit hinaus aktiver Tonischer Labyrinthreflex reagiert mit einer Ganzkörpertonusveränderung als Folge einer Kopfbewegung.
- Bei einem aktiven TLR vorwärts zeigt sich ein eher schlaffer Muskeltonus und eine gebeugte Körperhaltung, so dass der Mensch förmlich von der Erde angezogen wird und sich eher als bewegungsfaul zeigt. Bei einem aktiven TLR rückwärts zeigt sich ein eher starrer Muskeltonus und eine überstreckte Körperhaltung, oft mit einem Zehenspitzengang begleitet.
- Ein aktiver TLR behindert das Krabbeln.
- Er lässt keine stabile Wahrnehmung und Aufrechterhaltung des Gleichgewichts und des Ganzkörpertonus zu, räumliche Bezugspunkte erscheinen schwankend, schafft Orientierungs- und Strukturprobleme.
- Es fehlt ein gesicherter bzw. stabiler Aufbau in der Einschätzung von Raum/Richtung (oben/unten- rechts/links – vorne/hinten), Entfernung, Tiefe und Geschwindigkeit woraus Schwierigkeiten in der Unterscheidung von bspw. b / d oder 23 / 32 sowie Schulprobleme besonders in Mathe resultieren können aber auch das Erlernen des Lesens der Zeigeruhr.
Es gibt viele andere Erscheinungsbilder einer persistierenden Restreaktion des TLR.

"Großer Energieaufwand gegen eine unsichtbare Kraft!"
-
Herausbildung und Auslösung
Herausbildung
Der ATNR bildet sich in der 18. Schwangerschaftswoche aus, ist zum Zeitpunkt der Geburt vollständig entwickelt und bleibt bis zum 4. – 6. Lebensmonat bestehen.
Auslösung
Eine Kopfdrehung löst eine Streckung der gesichtsseitigen und eine Beugung der hinterhauptsseitigen Extremitäten aus, weshalb er auch als Fechterstellung bezeichnet wird.
-
„Das große Thema“
„Das große Thema“
Er teilt den Körper an der vertikalen Mittellinie in zwei Hälften – rechte und linke Körperhälfte.
-
Aufgaben
Aufgaben
- U. a. bahnt der ATNR vorgeburtlich homolaterale Bewegungsmuster, hilft unter der Geburt beim Geburtsprozess und trainiert nachgeburtlich jeweils eine Körperseite für das spätere Zusammenspiel der Augen mit den Händen.
- Mit gelungener Integration lässt er ein Kreuzen der Körpermittellinie ohne Tonusveränderung mit Kopfbewegung während der Stiftführung und mit den Augen zu für bspw. ein späteres flüssiges Schreiben und Lesen, ist er beteiligt an der Präferenzentwicklung für eine Hand, ein Auge, ein Ohr oder ein Bein und ermöglicht Fortbewegungen über eine flüssige Kreuzmusterbewegung auf dem Bauch, beim Krabbeln und Laufen.
-
Wirkung über die Waltezeit hinaus
Wirkung über die Waltezeit hinaus
Ein über die physiologische Waltezeit hinaus aktiver Asymmetrisch-Tonischer-Nackenreflex
- beeinträchtigt u.a. die Kreuzung der Körpermittellinie sowie ein Arbeiten vor der Mittellinie, welches bspw. durch das Schräglegen des Blattes oder Schräghalten des Kopfes kompensiert wird,
- behindert möglicherweise die Bildung einer Präferenz für eine Körperseite, eine eindeutige Rechts- oder Linkshändigkeit und
- es entstehen Raumlageprobleme wie Buchstabendreher.
- Die Raumaufteilung auf dem Papier kann möglicherweise nicht eingehalten werden,
- beim Kreuzen der Mittellinie mit den Augen durch Verfolgen eines Gegenstandes, einer Buchstabenreihe, … kommt es zu mittellinienbezogenen Augensprüngen,
- die Zeilen beim Lesen und Schreiben können verloren werden (nutzt kompensatorisch den Finger),
- das Abschreiben von Heft zu Heft kann problematisch sein,
- ein gesichertes Lesen, Schreiben und Rechtschreibung können behindert werden,
- es kann zu Diskrepanzen zwischen mündlichem und schriftlichem Ausdruck kommen
- einhergehend mit Stressreaktionen beim Verschriftlichen von Inhalten,
- es kann sich eine schlechte Handschrift einstellen, die bspw. nach unten hin abfällt oder in schwungvollen Endbewegungen ihren Ausdruck findet sowie
- ein Kompensationsaufbau in Form eines unreifen Stiftgriffes, in der Führung mit übermäßigem Druck.
Es gibt viele andere Erscheinungsbilder einer persistierenden Restreaktion des ATNR.
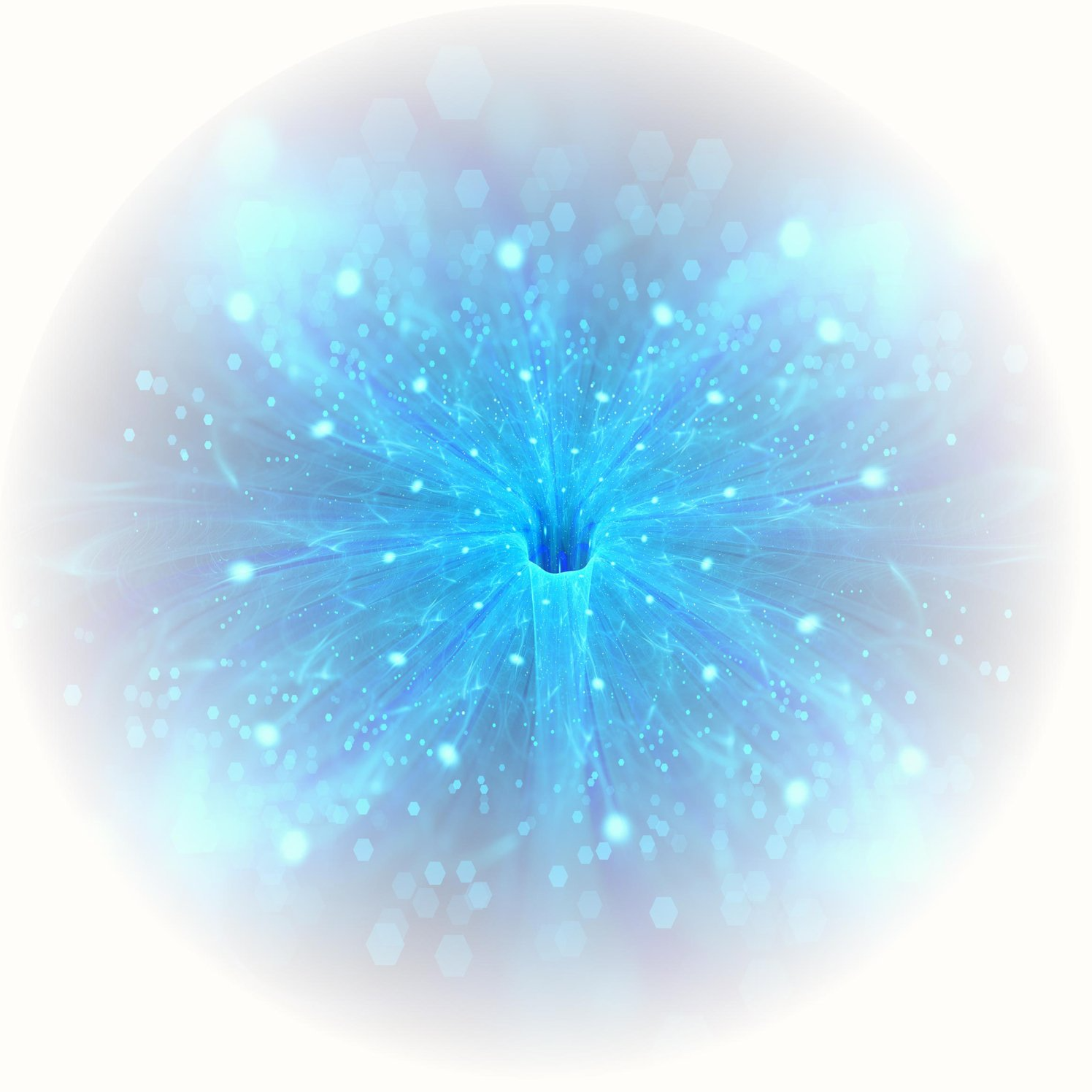
"Wie sitze ich, wie halte ich mich?“ oder „Das Sitzen als motorische Höchstleistung."
-
Herausbildung und Auslösung
Herausbildung
Der STNR ist für eine kurze Zeit nach der Geburt aktiv und tritt erneut zwischen dem 6. bis 9. Lebensmonat auf. Er wird zwischen dem 8. und 11. Lebensmonat gehemmt.
Auslösung
Einer Kopfbewegung in den Nacken folgt eine Armstreckung und eine Beinbeugung. Die Kopfbewegung zur Brust löst eine Armbeugung und Beinstreckung aus.
-
„Das große Thema“
„Das große Thema“
Er teilt den Körper an der horizontalen Mittellinie in zwei Hälften – obere und unterer Körperhälfte.
-
Aufgaben
Aufgaben
Mit gelungener Integration dient er der Bewältigung der Schwerkraft, bildet eine Brücke zum Krabbeln auf Händen und Knien, vervollständigt das Training der Augenmotorik und die Akkomodation (Fern- und Nahdistanz).
-
Wirkung über die Waltezeit hinaus
Wirkung über die Waltezeit hinaus
Ein über die physiologische Waltezeit hinaus aktiver Symmetrischer Tonischer Nackenreflex
- beeinträchtigt die Unabhängigkeit der Bewegungen des unteren und oberen Körperabschnittes durch jede Bewegung des Kopfes in der Horizontalen,
- bringt das Gleichgewichtszentrum und den Gesamtkörpertonus durcheinander und
- verhindert die Synchronisierung beider Körperhälften auf horizontaler Ebene.
- Kinder mit einem aktiven STNR zeigen selten ein Krabbeln, eher einen „Bärengang“ o. ein „Porutschen“, ziehen sich schnell zum Stand hoch, um zu laufen.
- Kommen sie ins Krabbeln, dann zeigen sie ein auffälliges Krabbelmuster, bspw. durch ein Rotieren der Hände nach außen, ein Anheben der Füße oder ein asynchrones Krabbelmuster.
- Im Stand zeigt sich eine gebeugte Haltung, der Gang zeigt sich stark „latschend“ mit fehlendem Schwingen der Arme.
- Im Sitzen zeigt sich ein Umschlingen der Beine um die Stuhlbeine herum, ein Hocken auf dem Stuhl, sitzen gerne im Zwischenfersensitz und wechseln häufig die Sitzposition. Am Tisch zeigt sich eine fast liegende Haltung beim ausdauernden Schreiben.
- Die motorische Koordination wie Hampelmannsprung, Rolle vorwärts, Schwimmen zeigt sich erschwert.
- Die Konzentration und Aufmerksamkeit ist durch die aufkommende Unruhe beeinträchtigt, auch die Hand-Auge-Koordination und die vertikalen Augenfolgebewegungen bspw. bei Ballspielen oder in Essenssituationen.
Es gibt viele andere Erscheinungsbilder einer persistierenden Restreaktion des STNR.