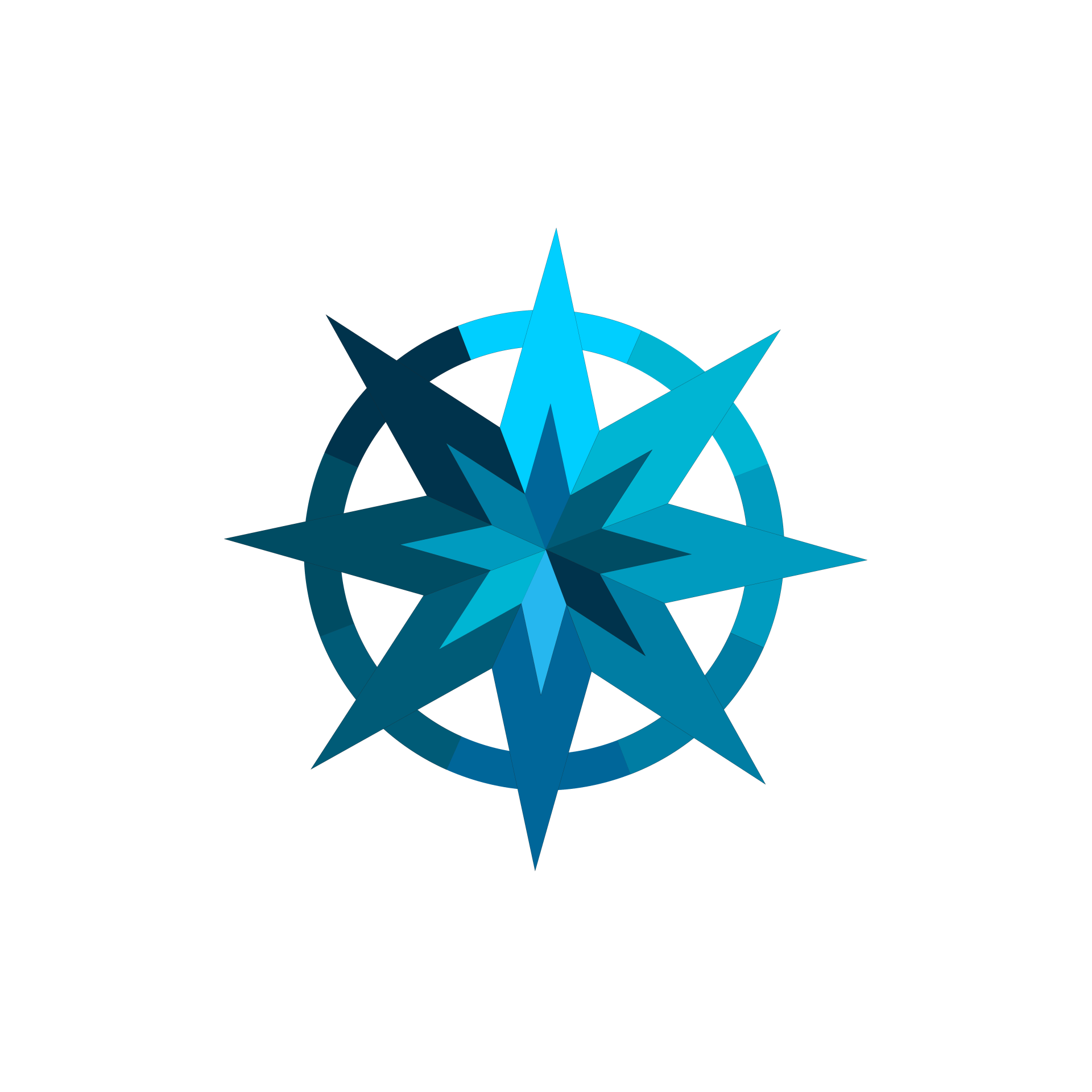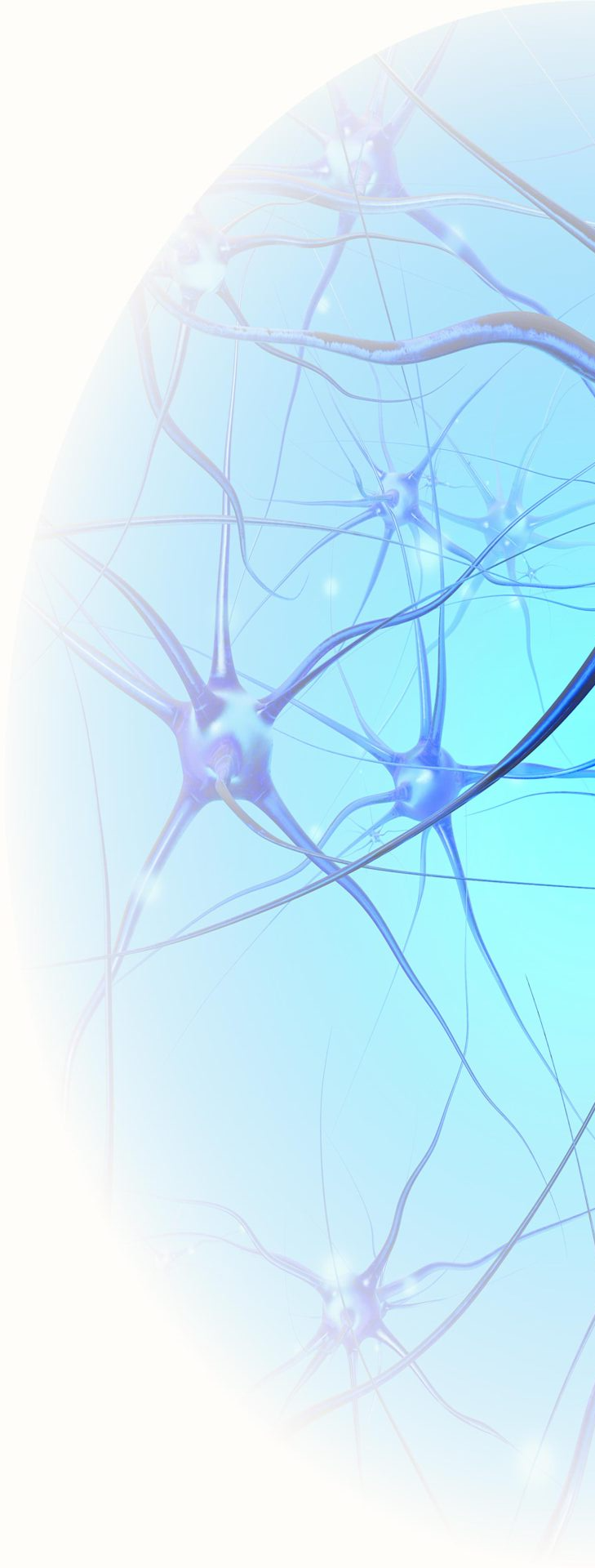Neuromotorische Entwicklung
"In dem Moment wo die Hirnfunktionen vollständig und ausgewogen ablaufen,
erreichen die Körperbewegungen ihr höchstes Maß an Anpassung,
ist Lernen eine relativ einfache Aufgabe und richtiges Verhalten ein ganz natürlicher Zustand."
Anna Jean Ayres - Bausteine der kindlichen Entwicklung, 1982


Die neuromotorische Entwicklung
Leben ist beständig mit Bewegung und Wahrnehmung verbunden. Schon während der Schwangerschaft, bei der Geburt und in den ersten Lebensmonaten schützt, nährt und bewegt sich das Kind mit Hilfe frühkindlicher Bewegungs- und Reaktionsautomatismen - den primitiven Reflexen mit unbewusster und unveränderbarer/stereotyper Bewegungsantwort -, die das Wachstum und die Hirnreifung fördern, ein erstes Überleben sichern und dem Säugling und Kleinkind helfen, die wichtigen Meilensteine in seiner Bewegungs- und Wahrnehmungsentwicklung im ersten Lebensjahr zu erreichen.
Jeder Reflex ist in der normalen Entwicklung des Zentralen Nervensystems vorprogrammiert und erfüllt zu bestimmten Zeiten der Entwicklung eine wichtige Aufgabe. Sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, sollte der betreffende Reflex überlagert werden, um anderen zu ermöglichen, ihren Einfluss auszuüben, die die Entwicklung des Nervensystems weiter vorantreiben.
Primitive Reflexe werden mit Fortschreiten der Gehirnreifung und der damit verbundenen Entwicklung der Willkürmotorik im Laufe des ersten Lebenshalbjahres nach und nach gehemmt und es folgt eine Umwandlung in Halte- und Stellreaktionen als bewusste und veränderbare Bewegungsantwort auf einen Reiz.
Durchläuft das Kind diese Phasen reibungslos, entstehen gut gesteuerte Bewegungen, eine gelungene Entwicklung und Zusammenarbeit aller Sinne, emotionale, soziale und kognitive Reife.
Bleiben die frühkindlichen Reflexe jedoch über die physiologische Waltezeit hinaus bestehen, werden also nicht vollständig und zeitgerecht gehemmt, dann kann die weitere nachfolgende Entwicklung zwar weiter voranschreiten, jedoch auf einem unsicheren Fundament. Sie müssen willentlich in den Bewegungsmustern kontrolliert werden und binden damit viel Energie in bewussten Gehirnarealen, die ansonsten für kognitive Leistungen zur Verfügung stünden.
D.h., fortbestehende frühkindliche Reflexe als Restreaktionen können allgemein zwar vom sich weiterentwickelndem Nervensystem kompensiert werden, irritieren aber das System, binden Aufmerksamkeit und benötigen Zeit und Kraft - Aspekte, die dann beim Lernen fehlen. Wenn zum Beispiel beim Bewegen des Kopfes der automatisch erfolgende Impuls der Arm- und Beinbewegung erfolgt, dann müssen andere Gebiete des Gehirns diesen versuchen zu unterdrücken.
Insbesondere mit steigenden Anforderungen bspw. mit Eintritt in die Schule, kann dies zu einer schnellen Erschöpfung bzw. Schwächung der Leistungsfähigkeit führen und somit auch Einfluss in der Ausbildung höherer kognitiver Fähig- und Fertigkeiten, wie Schreiben, Lesen, Rechnen, Fahrrad fahren, … und Verhalten haben.
Mögliche Ursachen neuromotorischer Unreife
Unterschiedliche Störeinflüsse können den kindlichen Entwicklungsprozess / den neuromotorischen Reifeprozess aus dem Gleichgewicht bringen und bewirken, dass Restreaktionen frühkindlicher Reflexe in einem nicht klinischen, aber dennoch irritierenden Umfang aktiv bleiben können als Hinweis auf eine neuromotorische Unreife bspw.
- in der Schwangerschaft durch Stress, längere Bettruhe, …,
- bei der Geburt durch einen schwierigen Geburtsprozess, Frühgeburt, Kaiserschnitt…,
- nach der Geburt durch die Trennung vom Kind, …,
- innerhalb des ersten Lebensjahres durch ein Auslassen oder nicht vollständiges Durchlaufen von Bewegungsphasen wie Drehen, Krabbeln, …
Mögliche Symptome neuromotorischer Unreife
Menschen mit einer neuromotorischen Unreife arbeiten stetig mit oder gegen eine unsichtbare Kraft (siehe Erläuterung Reflexe), aufgrund dessen sie eine schnellere Erschöpfbarkeit durch benötigte Kompensationsmechanismen mit steigender Anforderung zeigen.
Dies kann weitere Auswirkung auf unterschiedlichste Verhaltens- und Lernbereiche haben und sich bspw. in Wutanfällen, Ängsten, Verweigerungen, motorischer Unruhe zeigen, aber auch in einer Konzentrations-, Rechen-, Lese- oder Rechtschreibschwäche darstellen sowie in auffälligen Bewegungsmustern, in einem schlechten Schriftbild, einer Reizfilterschwäche, …